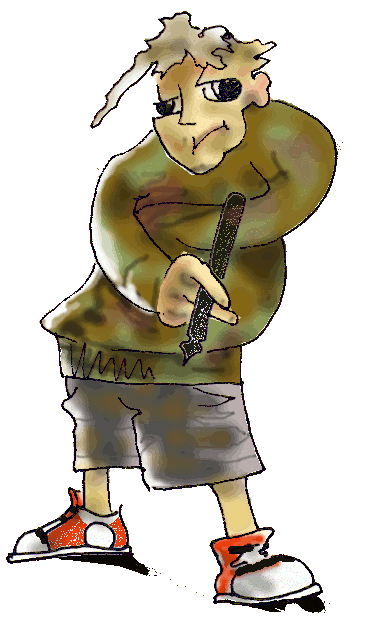das Problem mit der Literatur
... sie ernährt einen nicht.
Die Literatur ist keine gute Mutter. Das wissen alle, die schreiben. Sie wissen auch, dass Lamentieren nichts hilft, denn Literaten/innen werden auch gern und von vielen darauf hingewiesen, dass sie es schließlich so gewollt hätten. Man braucht ja nicht zu schreiben. Schreiben ist Luxus.
Der Autor der kleinen Philosophiegeschichte sieht das anders. Er zaubert zwischen den Querköpfen Voltaire und Rousseau die direkte Verbindungslinie zur französischen Revolution und vom dumpfen Loch zwischen Leibniz und Kant her das deutsche Pendant des fehlenden aufklärerischen Geistes, der denn auch in seiner Sichtweise den heiligen römischen Rückstand in der politischen Entwicklung des 18. Jahrhunderts bedingt. Wo nichts gedacht wird, da kann sich nichts bewegen. Luther, Gutenberg, Marx, Cäsar, die vier Evangelisten - sie alle würden unter-schreiben.
Der Geist hat noch immer das Fleisch bewegt, und das die Goldreserven, Weizentanker und Ölmagnaten, nicht umgekehrt. Somit ist die Literatur von je her Grundlagenforschung der Gesellschaftspolitik gewesen, doch die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen gelangt zu häufig aus dem Fokus. Zumal in einer Zeit, in der ein neuer salonfähiger Analphabetismus zu befürchten steht.
Muße und Wohlleben sind unerlässliche Voraussetzungen aller Kultur, sagt Max Frisch. Und trifft damit die Wurzel des Übels, denn gerade diese Muße und dieses Wohlleben scheinen der Gesellschaft der ewigen Möhre, die der Esel vor der Nase trägt, um im Kreis zu laufen, ganz fremd zu sein. Wer nicht hamstert, muss wenigstens unermüdlich das Rad drehen, sonst wird er suspekt. Damit sind die Architekten der soziologischen Entwicklung von morgen bereits generalverdächtig, es nicht wirklich ernst zu meinen mit dem Erwerb.
Tucholsky hat noch eine andere Beobachtung in Worte gekleidet: Eine der schauerlichsten Folgen der Arbeitslosigkeit, sagt er, ist wohl die, dass Arbeit als Gnade vergeben wird. Es ist wie im Krieg: wer die Butter hat, wird frech. Das alles merkt man, wenn es an die Kante des Wohllebens geht, dort wo ein Satz Autoreifen zur Problemstellung wird. WENN man dahin auswandert, dann erlebt man schnell die Reminiszenzen an die gute alte Buttermarkenzeit. Man kämpft ... um belanglose Dinge, deren Notwendigkeit gern unterschätzt wird. Essen, Trinken, Schlafen. Schreiben.
Irgendwie fällt mir dazu ein zweiter Aphorismus Tucholskys ein. Er hat was endgültiges. Obwohl möglicherweise ganz anders erdacht, schleicht sich doch durch seine Worte auch diese traurige Aussicht über endgültig versiegende Quellen, die mich angesichts der müden Kämpen vom Schlachtfeld der Wörter bedrückt.
Es gibt vielerlei Lärm. Aber es gibt nur eine Stille. [Kurt Tucholsky]
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer