Unterwelt
Wieder eine einsame Nacht in einer verlassenen Herberge, erbauliche Sprüche an der Wand und eine Stadt, die von Baudenkmälern strotzt. Mit einer Kombikarte habe ich alle römisch-arabischen Reste angesehen, später eine Reihe der ausgezeichneten Weine der Umgebung durchprobiert und dann einen Fallback in das Leben des Peregrino erlebt, als es Abend wurde und die Beine zu zittern begannen. Keine Lust gehabt, einsam in der Küche der Herberge einen Luxuswein zu nippen und zu lesen, was das Regal an Streuobst hergibt. So war ich gegen den Plan schon um sechs Uhr wieder auf den Beinen und zog die Tür der alten Wassermühle ins Schloss. Das Ziel war, den alten Stausee der Römer anzusehen, der sich in einiger Entfernung bei Proserpina befindet. Er bildet eine der drei Quellen, aus denen die Römer ihre Wasserversorgung der Stadt Emerita Augusta speisten. Das Wasser, das über das alte, angeblich größte Aquädukt Spaniens

, strömte, stammte von dort. Nach einem kurzen Weg durch das Dunkel der schlafenden Stadt und ihrer Randbezirke, über einen Hügel, von dem aus man bei Dämmerung einen herrlichen Blick auf Mérida rückwärts und vorwärts in die Extremadura werfen kann, erreiche ich den kleinen Ort, der seinen Namen der Gattin des Unterweltgottes verdankt.

Proserpina oder Persephone musste oder durfte nach ihrem Raub durch den Herrscher des Hades die Hälfte des Jahres im Schattenreich verbringen, den Rest über der Erde. Passend für das Wasser, das in Proserpina hinter massivem Mauerwerk seit Römerzeiten aufgestaut wird. Der Ort und der See sind ein Paradies für alle ausgetrockneten Seelen wie mich. Nur weil die Gastronomie in der Frühe noch geschlossen hat, verwerfe ich meine spontane Idee, zwischen den Pinien eines idyllischen Picknickplatzes meine bisher untätige Hängematte einzuhaken und die Füße für immer hochzulegen. Der Rest des Weges wird zu einem Traum. Zum ersten Mal, seit ich vor Wochen Sevilla verließ, erlebe ich das uneingeschränkte Glück, durch Natur zu wandern. Ein Viertel des Camino liegt hinter mir, bevor ich das hier erleben kann. Sandige Wege streuen sich zwischen lockerer Bewaldung in eine Landschaft, die von Schritt zu Schritt ihr Gesicht verändert. Rinder, Stiere, Hasen, Vögel bevölkern eine Parklandschaft, der das Wasser nie ganz auszugehen scheint. Weinberge wellen sich zwischen Hügeln wie Tischdecken auf. Immer mal wieder erscheint ein einzelnes Gehöft mit imposantem Gemäuer oder Kirchen, auf denen Störche einen Nistplatz finden. Bevor die Sonne ihren warmen Morgenmantel ablegt, bin ich schon in Aljucén und doch traurig, dass ich nicht im Ort vorher die brandneue städtische Herberge eingeweiht habe. Hier wird mit großem Eifer in den Camino de la Plata investiert. Ich sitze in einem Café und frage mich zum ersten Mal nicht, warum ich meinen Beinen den Weg aufgebürdet habe.
Neben der Herberge (ich bin mal wieder allein in einer Luxusunterkunft mit 2 Bädern, Riesenküche, Fernseher, Klimaanlage, Terrasse, …) gefällt mir auf Anhieb ein verfallenes Gebäude. Natürlich eine aufgegebene Kaserne der Guardia. Wenn nicht einbruchs- so doch ausbruchssicher, steht das Ding da wie eine Burgruine auf der Anhöhe und wartet auf die sanierende Hand. Als Gringo ahne ich natürlich nicht, welche Schicksale dort in der Franco-Zeit besiegelt worden sein mögen. Warum hege ich nur diesen morbiden Hang zu aufgegebenen Monumenten der Gewalt? Burgen, Schlösser, Kasernen, Panzer, Mauern, Festungen … beim Anblick der Eisenbahnbrücke von Mérida gestern war es mir, als hätte ich das Ding schon einmal geträumt - in einer Episode aus dem Bürgerkrieg.

Nun, meine Weinreise erfährt in Aljucén jedenfalls einen vorläufigen Höhepunkt, als ich den winzigen Supermarkt des Ortes nach den Erzeugnissen der umliegenden Winzerei absuche und schließlich bei einem 2L-Plastik-Gebinde aus Esparragalejo lande. Der Wein versucht nicht, durch bunte Flaschen (ein Weißer der Umgebung verpackt sich in blau!) auf seine besondere Provenienz hinzuweisen, sondern entfaltet im Glas ganz genau die Aromen, die ich nach meiner Wanderung durch die Weinberge erwartet habe. Er ist schwer, stark und erdig. Seine Farbe erinnert an konzentriertes Eisenoxid. Man könnte Tonkrüge damit glasieren. Er riecht frisch nach Kräutern und schwarzen Beeren, dabei dezent ätherisch nach -hm- ich komme nicht drauf. Der Traubensaft hat sicher nie ein Fass gesehen, macht aber den Eindruck von harzigen Anklängen, wie man sie sich von einem Barriquewein wünscht. In Frankreich hatten wir häufig die Erfahrung, dass die guten Weine aus dem Fass einige Jahre (nach meiner Einschätzung etwa sieben) in der Flasche brauchen, um die Tannine zu integrieren. Der Wein hier macht das (wahrscheinlich seit Römerzeiten) praktisch von selbst. Um zwei Uhr Stromausfall. Danach - möglicherweise ein Wunder - mein Glas leer.
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
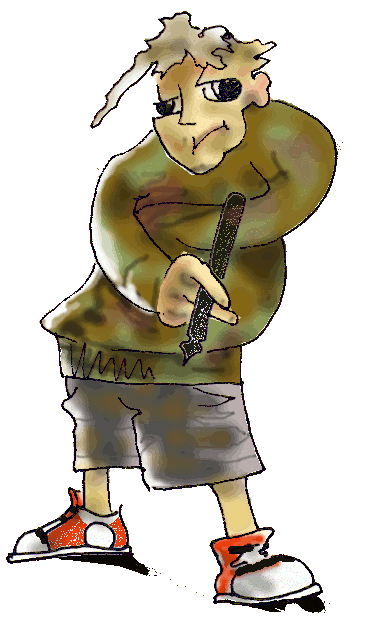
 , strömte, stammte von dort. Nach einem kurzen Weg durch das Dunkel der schlafenden Stadt und ihrer Randbezirke, über einen Hügel, von dem aus man bei Dämmerung einen herrlichen Blick auf Mérida rückwärts und vorwärts in die Extremadura werfen kann, erreiche ich den kleinen Ort, der seinen Namen der Gattin des Unterweltgottes verdankt.
, strömte, stammte von dort. Nach einem kurzen Weg durch das Dunkel der schlafenden Stadt und ihrer Randbezirke, über einen Hügel, von dem aus man bei Dämmerung einen herrlichen Blick auf Mérida rückwärts und vorwärts in die Extremadura werfen kann, erreiche ich den kleinen Ort, der seinen Namen der Gattin des Unterweltgottes verdankt.
 Proserpina oder Persephone musste oder durfte nach ihrem Raub durch den Herrscher des Hades die Hälfte des Jahres im Schattenreich verbringen, den Rest über der Erde. Passend für das Wasser, das in Proserpina hinter massivem Mauerwerk seit Römerzeiten aufgestaut wird. Der Ort und der See sind ein Paradies für alle ausgetrockneten Seelen wie mich. Nur weil die Gastronomie in der Frühe noch geschlossen hat, verwerfe ich meine spontane Idee, zwischen den Pinien eines idyllischen Picknickplatzes meine bisher untätige Hängematte einzuhaken und die Füße für immer hochzulegen. Der Rest des Weges wird zu einem Traum. Zum ersten Mal, seit ich vor Wochen Sevilla verließ, erlebe ich das uneingeschränkte Glück, durch Natur zu wandern. Ein Viertel des Camino liegt hinter mir, bevor ich das hier erleben kann. Sandige Wege streuen sich zwischen lockerer Bewaldung in eine Landschaft, die von Schritt zu Schritt ihr Gesicht verändert. Rinder, Stiere, Hasen, Vögel bevölkern eine Parklandschaft, der das Wasser nie ganz auszugehen scheint. Weinberge wellen sich zwischen Hügeln wie Tischdecken auf. Immer mal wieder erscheint ein einzelnes Gehöft mit imposantem Gemäuer oder Kirchen, auf denen Störche einen Nistplatz finden. Bevor die Sonne ihren warmen Morgenmantel ablegt, bin ich schon in Aljucén und doch traurig, dass ich nicht im Ort vorher die brandneue städtische Herberge eingeweiht habe. Hier wird mit großem Eifer in den Camino de la Plata investiert. Ich sitze in einem Café und frage mich zum ersten Mal nicht, warum ich meinen Beinen den Weg aufgebürdet habe.
Proserpina oder Persephone musste oder durfte nach ihrem Raub durch den Herrscher des Hades die Hälfte des Jahres im Schattenreich verbringen, den Rest über der Erde. Passend für das Wasser, das in Proserpina hinter massivem Mauerwerk seit Römerzeiten aufgestaut wird. Der Ort und der See sind ein Paradies für alle ausgetrockneten Seelen wie mich. Nur weil die Gastronomie in der Frühe noch geschlossen hat, verwerfe ich meine spontane Idee, zwischen den Pinien eines idyllischen Picknickplatzes meine bisher untätige Hängematte einzuhaken und die Füße für immer hochzulegen. Der Rest des Weges wird zu einem Traum. Zum ersten Mal, seit ich vor Wochen Sevilla verließ, erlebe ich das uneingeschränkte Glück, durch Natur zu wandern. Ein Viertel des Camino liegt hinter mir, bevor ich das hier erleben kann. Sandige Wege streuen sich zwischen lockerer Bewaldung in eine Landschaft, die von Schritt zu Schritt ihr Gesicht verändert. Rinder, Stiere, Hasen, Vögel bevölkern eine Parklandschaft, der das Wasser nie ganz auszugehen scheint. Weinberge wellen sich zwischen Hügeln wie Tischdecken auf. Immer mal wieder erscheint ein einzelnes Gehöft mit imposantem Gemäuer oder Kirchen, auf denen Störche einen Nistplatz finden. Bevor die Sonne ihren warmen Morgenmantel ablegt, bin ich schon in Aljucén und doch traurig, dass ich nicht im Ort vorher die brandneue städtische Herberge eingeweiht habe. Hier wird mit großem Eifer in den Camino de la Plata investiert. Ich sitze in einem Café und frage mich zum ersten Mal nicht, warum ich meinen Beinen den Weg aufgebürdet habe.
 Nun, meine Weinreise erfährt in Aljucén jedenfalls einen vorläufigen Höhepunkt, als ich den winzigen Supermarkt des Ortes nach den Erzeugnissen der umliegenden Winzerei absuche und schließlich bei einem 2L-Plastik-Gebinde aus Esparragalejo lande. Der Wein versucht nicht, durch bunte Flaschen (ein Weißer der Umgebung verpackt sich in blau!) auf seine besondere Provenienz hinzuweisen, sondern entfaltet im Glas ganz genau die Aromen, die ich nach meiner Wanderung durch die Weinberge erwartet habe. Er ist schwer, stark und erdig. Seine Farbe erinnert an konzentriertes Eisenoxid. Man könnte Tonkrüge damit glasieren. Er riecht frisch nach Kräutern und schwarzen Beeren, dabei dezent ätherisch nach -hm- ich komme nicht drauf. Der Traubensaft hat sicher nie ein Fass gesehen, macht aber den Eindruck von harzigen Anklängen, wie man sie sich von einem Barriquewein wünscht. In Frankreich hatten wir häufig die Erfahrung, dass die guten Weine aus dem Fass einige Jahre (nach meiner Einschätzung etwa sieben) in der Flasche brauchen, um die Tannine zu integrieren. Der Wein hier macht das (wahrscheinlich seit Römerzeiten) praktisch von selbst. Um zwei Uhr Stromausfall. Danach - möglicherweise ein Wunder - mein Glas leer.
Nun, meine Weinreise erfährt in Aljucén jedenfalls einen vorläufigen Höhepunkt, als ich den winzigen Supermarkt des Ortes nach den Erzeugnissen der umliegenden Winzerei absuche und schließlich bei einem 2L-Plastik-Gebinde aus Esparragalejo lande. Der Wein versucht nicht, durch bunte Flaschen (ein Weißer der Umgebung verpackt sich in blau!) auf seine besondere Provenienz hinzuweisen, sondern entfaltet im Glas ganz genau die Aromen, die ich nach meiner Wanderung durch die Weinberge erwartet habe. Er ist schwer, stark und erdig. Seine Farbe erinnert an konzentriertes Eisenoxid. Man könnte Tonkrüge damit glasieren. Er riecht frisch nach Kräutern und schwarzen Beeren, dabei dezent ätherisch nach -hm- ich komme nicht drauf. Der Traubensaft hat sicher nie ein Fass gesehen, macht aber den Eindruck von harzigen Anklängen, wie man sie sich von einem Barriquewein wünscht. In Frankreich hatten wir häufig die Erfahrung, dass die guten Weine aus dem Fass einige Jahre (nach meiner Einschätzung etwa sieben) in der Flasche brauchen, um die Tannine zu integrieren. Der Wein hier macht das (wahrscheinlich seit Römerzeiten) praktisch von selbst. Um zwei Uhr Stromausfall. Danach - möglicherweise ein Wunder - mein Glas leer.