Nachts im Rollstuhl

Hinter der nächsten Palme trat eine Gestalt hervor, seltsam zweidimensional im künstlichen Licht. Bräunlich-grünlich gekleidet wirkte sie im Schein der Laternen wie aus Sand gemacht. An ihrer Hand ein Benzinkanister.
„Ich tue es. Ich tue es. Wirklich, ich tue es.“ sagte der Mann. Pecho sah erst ihn an, dann einige gurrende Tauben auf den glatten Fliesen, eine Möwe, die stolz wie ein faschistischer Generalisimo in die Taubenschar einmarschierte, hörte das Murren aus der gefiederten Meute, schließlich das kantige Geläut des Kanisters, als dieser auf dem Boden abgesetzt wurde.
„Ich tue es“, sagte der Sandmann und setzte sich auf seinen Benzinvorrat. Pecho hielt stracks auf das Glasportal der Embajada zu, hoffte, dass die mächtige Drehtür in der Mitte nachts in Betrieb sein würde. Die trockene Luft der Sahara zwickte ihm im Nacken.
Drinnen säuselten muffige Klänge vom Band, ein unentschlossenes musikalisches Geseier, wie es um diese Zeit an jedem Ort der Welt vor sich hin plätschern könnte, um den Geruch von Desinfektionsmitteln zu überdecken, stille Orte eingeschlossen. Es heißt, dass Hühner besser legen, wenn man sie derart beschallt, Bienen weniger aggressiv sind und Kunden die Kaufhäuser leer kauften. Hier wurde ganz offensichtlich das Mobiliar musikalisch berieselt, Teppichläufer und Hydrokulturen. An Lebewesen herrschte abgesehen von vier Kübeln voll Philodendren spürbarer Mangel. Dafür stimmte die Luftfeuchtigkeit.
Pecho kurvte um die Teppiche herum mit ziemlicher Freude am Quietschen der Reifen auf den frisch gewachsten Marmorböden zur Rezeption hinüber. Der Empfang erinnerte aus seiner Sicht heraus an einen Altar, die Fächerwand dahinter mit ihren Messingplaketten an kunstvolle Retabeln, in denen die Gläubigen ihre Wünsche lagern, die Schlüssel zu ihren Suiten im Himmel, Urlaubsträume und Stadtpläne für die verlorenen Seelen. Der Priester erschien nach dem dritten Plink an der goldenen Knopfglocke, richtete den Talar und hob sein schweres Gesicht über die Empfangstheke, offensichtlich ein karibischer Epigone: „Ja, bitte?“
„Inci Ana Nour“, sagte Pecho.
Der Portier griff sich ein Häufchen Briefe, die verwaist auf dem Marmor des Thresens lagen, sortierte sie beiläufig in die Nischen seiner Heiligen ein und antwortete mit Verzögerung. „Eine Frau mit dem Namen wurde gestern nachmittag drüben ins Diner gebracht. Später haben sie sie abgeholt. Ich habe das von hier aus zufällig mitbekommen.“
„Von hier aus zufällig mitbekommen, wie die Frau hieß?“
Nun klingelte der Portier mit der Spitze des Zeigefingers an seinem Ohrläppchen. „Dort kommen Gäste her, hier gehen Gäste hin, sie reden, man hört, man vergißt oder erinnert sich dran. Wie kommen Sie darauf, hier nachzufragen? Mich zu fragen?“
Der Rollstuhlfahrer ließ seinen Greifreifen los und führte den Zeigefinger zum Ohr, um an seinem Ohrläppchen auch mal zu klingeln. Fühlte sich gut an. Jedenfalls lächelte er.
Der Portier nickte zufrieden: „Sehen Sie?!“
„Also drüben“, sagte Pecho und drehte auf der Stelle, kurbelte sich dann um volle 360° wieder dem Portier entgegen, „Wissen Sie, dass sich draußen jemand verbrennen will?“
„Der Kerl mit dem Kanister?“ seufzte der Portier und schob sich eine Brille auf die Nase, um die Adresse auf dem letzten Brief zu entziffern, „Traurige Geschichte mit den Sinpapeles.“
„Der Bursche will sich verbrennen, weil er keine Aufenthaltsgenehmigung hat?“
„Er denkt wohl, wir wären eine Botschaft. Ich weiß nicht, gegen was der protestieren will.“
„Also will sich der arme Kerl tatsächlich draußen verbrennen? Aber warum mitten in der Nacht? Zünden sich diese Typen nicht tagsüber an, wenn die Presse und die Touristen zusehen?“
„Tagsüber würden sie ihn verhaften.“
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
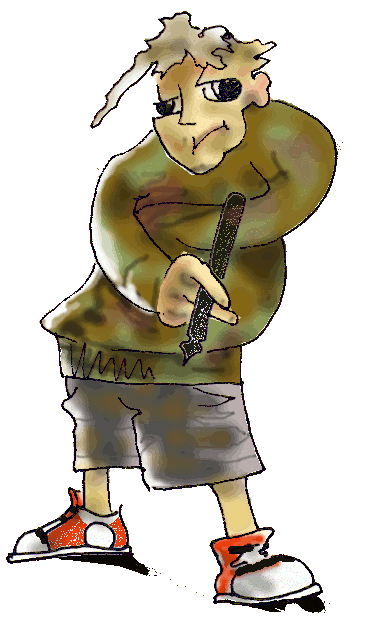
 Ausschnitt aus dem nächsten Roman der Chill-Bill-Reihe, Handlungsort: TorremolinosHinter der nächsten Palme trat eine Gestalt hervor, seltsam zweidimensional im künstlichen Licht. Bräunlich-grünlich gekleidet wirkte sie im Schein der Laternen wie aus Sand gemacht. An ihrer Hand ein Benzinkanister.
Ausschnitt aus dem nächsten Roman der Chill-Bill-Reihe, Handlungsort: TorremolinosHinter der nächsten Palme trat eine Gestalt hervor, seltsam zweidimensional im künstlichen Licht. Bräunlich-grünlich gekleidet wirkte sie im Schein der Laternen wie aus Sand gemacht. An ihrer Hand ein Benzinkanister.