Selbstähnlichkeit
Die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts brachten bei vielen Menschen eine spätpsychedelische Neigung hervor, halbwissenschaftlichen Kuriositäten eine Art göttlicher Botschaft anzudeuten. Es ist die Zeit der schwarzen Löcher, der Lockenwicklerdimensionen, der Wurmlöcher, stereografischer Bildchen, des Schmetterlings, der in Burma unser Wetter bestimmt, die Geburtsstunde eines ganzen Teilchenzoos von Up- und Down- und Subquarks, von Unsterblichkeitsgenen, IQ-Messungen, und eben auch der Mandelbrotmengen. Kein Mensch, außer denen, die ausreichend Gras geraucht haben, konnte bisher den mathematischen Sinn in Mandelbrots Grafiken erklären, als nur, dass man da was ganz außergewöhnliches sehen kann. Nämlich das Chaos.

Nun, das Chaos sahen ja schon die Griechen und erfanden einen Namen dafür. Zweitausend Jahre später setzten Mathematiker noch vor dem ersten Weltkrieg, den Formelapparat für das, was in den Achtzigern die Pop-Wiss zu einem Event stilisierte. Neu war das also eigentlich nie. Neu war wohl eher die Deutung, die man dem ganzen gewaltsam antat, denn Mandelbrot und seine Mengen zeigen weder das Chaos, noch seine Grenzen, sie zeigen lediglich das relativ witzlose Bild, das entsteht, wenn man versucht, sich in zwei Dimensionen mit Hilfe von Helligkeit und Farbe einen Chart zu erstellen, auf dem markiert ist, wo eine seit 1905 gut untersuchte Funktion nicht konvergiert.

Wie kann man den Vorgang auf das Alltagsleben übertragen? Man fertigt ein Foto vom Pferdekopfnebel an und fingiert Entfernungsmessungen, indem man den Lichtreflexen nach dem Dopplereffekt Farben zuordnet, sie also relativ willkürlich bunt anmalen lässt. Das Ergebnis ist phänomenal. Aber was begeistert uns daran so sehr? Doch nicht die Tatsache, dass es tatsächlich einen Pferdekopfnebel gibt, bzw. einen Sternhaufen, den wir so nennen und der, wenn wir ihn vom Raumschiff aus mit dem Fernrohr beobachten könnten, ganz anders als auf dem ‘Foto’ aussähe? Nein, was uns tatsächlich begeistert, ist das bunte Bild und die Botschaft, die wir ihm einfach mal mitgeben.

Man hätte auch umgekehrt den Pferdekopfnebel als Chaosfoto deklarieren und ihm die im Bild geradezu immanente Fähigkeit zuschreiben können, durch einen Flügelschlag die Wirbelstürme auf der Erde auszulösen. Man hätte einen bestimmten Prozentsatz von ihm wie bei den Eisbergen in eine andere, unsichtbare Dimension des Chaos verschieben und das ganze ‘grafische Darstellung eines Wurmlochs’ nennen können. Oder das Ding am Himmel mit dem Inhalt einer Amöbe vergleichen und die Selbstähnlichkeit des Universums als ein in der Bibel bereits angelegtes* Urphänomen postulieren.

Selbstähnlichkeit ist tatsächlich ein Phänomen. Aber kein mathematisches. Es ist ein erkenntnistheoretisches Phänomen und faktisch unverzichtbar überhaupt für jede Art von Wahrnehmung im logischen Sinn. Es führt uns vor Augen, dass wir nur sehen können, was wir kennen, oder einen Schritt weiter: es führt uns vor Augen, dass das, was wir vor Augen glauben, eben das ist, was wir da vermuten, weil wir es da erwarten. Selbstähnlichkeit ist die Erkenntnis, dass es keine Erkenntnis außer der Selbsterkenntnis gibt.
Damit ist Selbsterkenntnis der ureigentliche, vollständige, definierende und ganze Kern des künstlerischen Schaffens an sich. Und da werden die Ansätze der Achtziger wieder sehr spannend, denn sie zeigen den Durst nach der Betrachtung dessen, was wir hier eigentlich tun. Auf der Erde. Im Leben. Sozusagen den wissenschaftlich säkularisierten esoterischen Drang nach Abgrenzung von Gewissem und Ungewissen, Sein und Nichts. Und das auf möglichst breitenwirksame Weise.
Ich hab mir damals Gedanken zur Art gemacht, wie auf dem Schulhof über Filme geredet wird. Der Ablauf war schematisch eigentlich immer gleich. Man versuchte, sich zunächst an einer Handvoll repräsentativer Szenen die eigentliche Story zu erklären, einigte sich meist auf eine am klarsten die Botschaft der Geschichte transportierende Sequenz, suchte dann innerhalb dieser den sinnstiftenden Dialog und darin möglichst den einen Satz, respektive das eine Wort, das die Geschichte so klar trug, dass man sie in eine SMS hätte packen können. Hätte es SMS damals schon gegeben.
Im Business nennt man diesen Vorgang des Komprimierens, Essenzierens, Eindampfens und Verdichtens Pitching. Man pitcht einen Film, indem man ihn in drei Sätzen erzählt. Wenn das aber funktioniert, warum funktioniert das dann? Die Antwort lautet: wegen der Selbstähnlichkeit. Der Prozess der Wahrnehmung eines Films ist selbstähnlich wie die Wahrnehmung selbst. Ein Film funktioniert, wenn er sich selbst abbildet und damit dem Zuschauer die Chance gibt, sich selbst zu erkennen. In der einen Szene, dem einen Satz, dem ganzen Film. Indem die Zuschauer sich selbst in der Fünfminutenpause als Urheber dieses einen knackigen Dialogs feiern – vielleicht weil sie ihn mehr als alle anderen gesehen zu haben glauben – werden sie nachträglich noch zu Hauptakteuren.

Die Identifikation glückt, indem sich die Darsteller mit ihrer Rolle, die Dialoge mit ihren Sprechern, die Musik mit dem Bild, das Bild mit der Botschaft, der Zuschauer mit den Bildern und die Details mit dem Ganzen identifizieren lassen. Film ist wie alle Kunst gelebte Selbstähnlichkeit. Wir entdecken uns selbst in dem, was wir betrachten. Und damit in jedem Detail. Gute Geschichten sind selbstähnlich. Sie berichten von einem, der sich selbst auf das Abenteuer des Selbsterkenntnis begibt. Sie berichten von einem, der sich nicht scheut, diesem Artikel bis hier hin zu folgen.
Und über das Ende hinaus. Denn hier beginnt möglicherweise wirklich das Chaos.
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
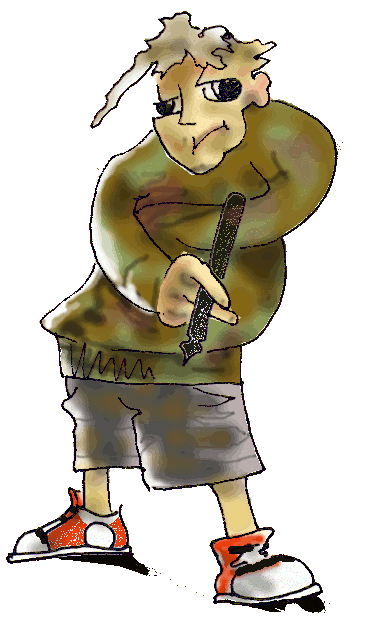
 Nun, das Chaos sahen ja schon die Griechen und erfanden einen Namen dafür. Zweitausend Jahre später setzten Mathematiker noch vor dem ersten Weltkrieg, den Formelapparat für das, was in den Achtzigern die Pop-Wiss zu einem Event stilisierte. Neu war das also eigentlich nie. Neu war wohl eher die Deutung, die man dem ganzen gewaltsam antat, denn Mandelbrot und seine Mengen zeigen weder das Chaos, noch seine Grenzen, sie zeigen lediglich das relativ witzlose Bild, das entsteht, wenn man versucht, sich in zwei Dimensionen mit Hilfe von Helligkeit und Farbe einen Chart zu erstellen, auf dem markiert ist, wo eine seit 1905 gut untersuchte Funktion nicht konvergiert.
Nun, das Chaos sahen ja schon die Griechen und erfanden einen Namen dafür. Zweitausend Jahre später setzten Mathematiker noch vor dem ersten Weltkrieg, den Formelapparat für das, was in den Achtzigern die Pop-Wiss zu einem Event stilisierte. Neu war das also eigentlich nie. Neu war wohl eher die Deutung, die man dem ganzen gewaltsam antat, denn Mandelbrot und seine Mengen zeigen weder das Chaos, noch seine Grenzen, sie zeigen lediglich das relativ witzlose Bild, das entsteht, wenn man versucht, sich in zwei Dimensionen mit Hilfe von Helligkeit und Farbe einen Chart zu erstellen, auf dem markiert ist, wo eine seit 1905 gut untersuchte Funktion nicht konvergiert.
 Skizze: Tee - in AusschnittenWie kann man den Vorgang auf das Alltagsleben übertragen? Man fertigt ein Foto vom Pferdekopfnebel an und fingiert Entfernungsmessungen, indem man den Lichtreflexen nach dem Dopplereffekt Farben zuordnet, sie also relativ willkürlich bunt anmalen lässt. Das Ergebnis ist phänomenal. Aber was begeistert uns daran so sehr? Doch nicht die Tatsache, dass es tatsächlich einen Pferdekopfnebel gibt, bzw. einen Sternhaufen, den wir so nennen und der, wenn wir ihn vom Raumschiff aus mit dem Fernrohr beobachten könnten, ganz anders als auf dem ‘Foto’ aussähe? Nein, was uns tatsächlich begeistert, ist das bunte Bild und die Botschaft, die wir ihm einfach mal mitgeben.
Skizze: Tee - in AusschnittenWie kann man den Vorgang auf das Alltagsleben übertragen? Man fertigt ein Foto vom Pferdekopfnebel an und fingiert Entfernungsmessungen, indem man den Lichtreflexen nach dem Dopplereffekt Farben zuordnet, sie also relativ willkürlich bunt anmalen lässt. Das Ergebnis ist phänomenal. Aber was begeistert uns daran so sehr? Doch nicht die Tatsache, dass es tatsächlich einen Pferdekopfnebel gibt, bzw. einen Sternhaufen, den wir so nennen und der, wenn wir ihn vom Raumschiff aus mit dem Fernrohr beobachten könnten, ganz anders als auf dem ‘Foto’ aussähe? Nein, was uns tatsächlich begeistert, ist das bunte Bild und die Botschaft, die wir ihm einfach mal mitgeben.
 Man hätte auch umgekehrt den Pferdekopfnebel als Chaosfoto deklarieren und ihm die im Bild geradezu immanente Fähigkeit zuschreiben können, durch einen Flügelschlag die Wirbelstürme auf der Erde auszulösen. Man hätte einen bestimmten Prozentsatz von ihm wie bei den Eisbergen in eine andere, unsichtbare Dimension des Chaos verschieben und das ganze ‘grafische Darstellung eines Wurmlochs’ nennen können. Oder das Ding am Himmel mit dem Inhalt einer Amöbe vergleichen und die Selbstähnlichkeit des Universums als ein in der Bibel bereits angelegtes** nach seinem Ebenbilde Urphänomen postulieren.
Man hätte auch umgekehrt den Pferdekopfnebel als Chaosfoto deklarieren und ihm die im Bild geradezu immanente Fähigkeit zuschreiben können, durch einen Flügelschlag die Wirbelstürme auf der Erde auszulösen. Man hätte einen bestimmten Prozentsatz von ihm wie bei den Eisbergen in eine andere, unsichtbare Dimension des Chaos verschieben und das ganze ‘grafische Darstellung eines Wurmlochs’ nennen können. Oder das Ding am Himmel mit dem Inhalt einer Amöbe vergleichen und die Selbstähnlichkeit des Universums als ein in der Bibel bereits angelegtes** nach seinem Ebenbilde Urphänomen postulieren.
 Selbstähnlichkeit ist tatsächlich ein Phänomen. Aber kein mathematisches. Es ist ein erkenntnistheoretisches Phänomen und faktisch unverzichtbar überhaupt für jede Art von Wahrnehmung im logischen Sinn. Es führt uns vor Augen, dass wir nur sehen können, was wir kennen, oder einen Schritt weiter: es führt uns vor Augen, dass das, was wir vor Augen glauben, eben das ist, was wir da vermuten, weil wir es da erwarten. Selbstähnlichkeit ist die Erkenntnis, dass es keine Erkenntnis außer der Selbsterkenntnis gibt.
Selbstähnlichkeit ist tatsächlich ein Phänomen. Aber kein mathematisches. Es ist ein erkenntnistheoretisches Phänomen und faktisch unverzichtbar überhaupt für jede Art von Wahrnehmung im logischen Sinn. Es führt uns vor Augen, dass wir nur sehen können, was wir kennen, oder einen Schritt weiter: es führt uns vor Augen, dass das, was wir vor Augen glauben, eben das ist, was wir da vermuten, weil wir es da erwarten. Selbstähnlichkeit ist die Erkenntnis, dass es keine Erkenntnis außer der Selbsterkenntnis gibt.
 Die Identifikation glückt, indem sich die Darsteller mit ihrer Rolle, die Dialoge mit ihren Sprechern, die Musik mit dem Bild, das Bild mit der Botschaft, der Zuschauer mit den Bildern und die Details mit dem Ganzen identifizieren lassen. Film ist wie alle Kunst gelebte Selbstähnlichkeit. Wir entdecken uns selbst in dem, was wir betrachten. Und damit in jedem Detail. Gute Geschichten sind selbstähnlich. Sie berichten von einem, der sich selbst auf das Abenteuer des Selbsterkenntnis begibt. Sie berichten von einem, der sich nicht scheut, diesem Artikel bis hier hin zu folgen.
Die Identifikation glückt, indem sich die Darsteller mit ihrer Rolle, die Dialoge mit ihren Sprechern, die Musik mit dem Bild, das Bild mit der Botschaft, der Zuschauer mit den Bildern und die Details mit dem Ganzen identifizieren lassen. Film ist wie alle Kunst gelebte Selbstähnlichkeit. Wir entdecken uns selbst in dem, was wir betrachten. Und damit in jedem Detail. Gute Geschichten sind selbstähnlich. Sie berichten von einem, der sich selbst auf das Abenteuer des Selbsterkenntnis begibt. Sie berichten von einem, der sich nicht scheut, diesem Artikel bis hier hin zu folgen.