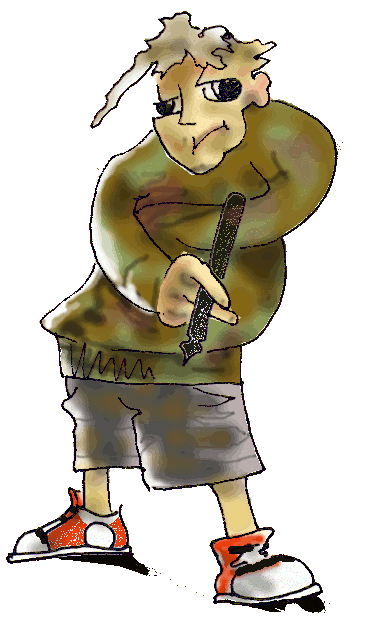Fresken
Zeitgenosse da Vincis und Dürers, von Kolumbus und nebenbei auch des ersten Globus, einer Reihe Florentiner Potentaten, die man heute ihrer Giftmischerei, Intrigen und als Päpste kennt, war Buonarroti. Der Engel Michael erhielt im Alter von 33 Jahren den Auftrag, des Papstes Kapelle zu tapezieren. Michelangelo, der die Malerei als Mädchensache ansah und auch schon mal in der von ihm bevorzugten Kunst des Bildhauens sein Werk betrügerisch mit künstlicher Patina bepinselt als Antikenstück verkaufte, hat seine Kunst an der Wand in Rom hinreichend reputiert.
Jedenfalls ging sein Schaffen in der Sixtinischen Kapelle neben der einen oder anderen Plastik (David und Pietá z.B.) in das kulturelle Gedächtnis der Menschheit ein wie kaum ein anderes Werk vor und nach ihm. Dass er sich auch in der Poesie und im Festungsbau betätigte, wird die Betrachter seiner zeitgenössischen Künstlerkollegen nicht überraschen. Da Vinci glänzt ja auch schon mal mit Proportionsstudien und Hubschraubermodellen. Aber Michelangelo ist konträr zu dieser Universalität eine schon fast autistische Begabung eigen, in einem Auftrag nahezu rasend ganz aufzugehen.
Auch körperlich. Er muss sich in der Kapelle bei der Arbeit halb tot geschuftet haben. Wie ihm das Leder der eigenen Haut hinten auf dem Malgerüst schrumpft, um ihm vorne von Farbkleksen, Wachs und Firnis schrundig und teigig zu werden, hat er noch selbst bezeugt. Sein Vater soll dokumentiert haben, sonstwas geben zu wollen, wäre der Sohn von dieser Qual endlich befreit. Buonarroti hielt durch und malte sich durch die Schöpfungsgeschichte, Moses und Jesus, zeigte dessen Genealogie, die Propheten und Sibyllen in ihrem wegweisenden Tun hin zum endgültigen Gericht Gottes über die Welt.
Das jüngste Gericht allerdings malte Michelangelo erst gute zwanzig Jahre nach dem Rest. Und dort auch rundet sich der Eindruck des ganzen, Buonarroti habe sich als Künstler selbst dargestellt. In seinem nahezu gottgleichen Tun als Erschaffer eines Konterfeis ähnlich Gott, der sich den Menschen schafft. Denn der Maler schafft wie Gott in der Bibel und er zeigt Gott auch so schön comichaft menschlich, wenn sich der Schöpfer nach getanem Werk im Äther verflüchtigt. Michelangelo hat unter den Augen des Papstes Gottes - na, sagen wir vornehm: Hintern gemalt.
Aber nicht nur das beeindruckt als Zeugnis des außerhalb seiner Zeit stehenden Künstlers, sondern auch die Tatsache, dass er in seinem letzten Werk dann, bevor die Hosenmaler anfingen, Bilder wieder kirchenkonform umzupinseln, sich selbst (fast) ins Zentrum seines Gemäldes stellte. Denn im jüngsten Gericht steigt Buonarroti aus seiner Haut als schmutziger Handwerker und geschundener Bartholomäus und entpuppt so sein wahres Wesen als Bote einer göttlichen Welt.
Die Statue von David enthüllt die gesamte Krux. Sie allerdings nicht Bestandteil der Sixtinischen Kapelle, trägt diese Last des Schaffens eben durch ihre überzeugende Leichtigkeit vor - oder sagen wir: die Selbstverständlichkeit, mit der das Kunstwerk sich als Bestandteil des ihn verkörpernden Marmors inszeniert. Andere Bildhauer hatten sich vor Michelangelo bereits mit dem Steinblock beschäftigt, ihm aber nicht das Geheimnis entlocken können, das Michelangelo darin sah. Von ihm könnte, wird vielleicht auch der vielfach in Hollywoodfilmen zitierte Gedanke eines Bildhauers stammen, der Künstler habe lediglich die Aufgabe, die Skulptur im Stein von Überflüssigem zu befreien.
In der Sixtinischen Kapelle scheint sich der Künstler selbst - zumindest in seinem jüngsten Gericht auf asketische Weise im Tun alles Überflüssigen zu entledigen. Das immerhin gelang der Ausstellung von auf Stoffbahnen gedruckten Reproduktionen seiner Fresken in Köln ganz gut darzustellen. Die Perspektive, deren Wesen angeblich Thema der Ausstellung zu sein hat, nunja, die Perspektive ist wohl das einzige, das man auch mit dicken Brillengläsern nicht finden wird.
Denn sie geht bei der Projektion auf ebene Flächen größtenteils verloren. Glücklich ist, dass man sich nicht in Rom durch die Touristenschlange der Vatikanbesucher quälen muss, um die Werke zu betrachten. Aber da scheint auch das Problem der Ausstellung zu liegen. Der Vatikan hat Michelangelos Werk nicht gerade eben pfleglich behandelt. Ein Wunder, dass die Tapete dennoch hielt. 500 Jahre. Bis man sie zu restaurieren plante.
Nun sind Restaurierungen der Sixtina wohl zu allen Zeiten nötig gewesen, wie auch der Dom zu Köln eine ewige Baustelle ist, aber Michelangelos Fresken ist man wohl bis dato eher mit ungeeigneten Mitteln wie Retsina-Waschungen zu Leibe gerückt, bis ein vermeintlich japanisches Unternehmen als Sponsor auftrat, um die Sache richtig zu machen. Genaueres ist Hörensagen, aber es scheint, als habe man sich damals von Sponsorenseite die Filmrechte gesichert, was die Dürftigkeit der Ausstellungsmedien und -kataloge erklären hilft. Und nebenbei auch den Eintrittspreis.
Aber gut, billiger als Rom, und in Köln Kalk werden einem auch nicht die Portemonnaies in der U-Bahn geklaut, während man sich über die exorbitanten Preise für ein handteller großes Stück kalte Pizza wundert. Und die Terrorgefahr ist geringer als am Petersplatz. Das Epizentrum des künstlerischen Erschauderns über die Schaffenskraft nahezu göttlicher Magie am ausgehenden Mittelalter, das Göthen und Co. im Herzen Roms fanden, bebt in Köln nur noch als leiser Erdstoß. Oder leichtes Zittern. Dennoch, ein halbes Jahrtausend nach Buonarroti merkt man es noch, auch in der Reproduktion weitab der Heimat.
Die Ausstellung lohnt sich. Auf eine Sache, die die Aussteller wohl vollkommen verschwitzt haben, sollte man und kann man auch ohne Katalog und Audioguide achten: die inverse Perspektive. Viel Spaß bei der Recherche, was damit gemeint ist!
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer