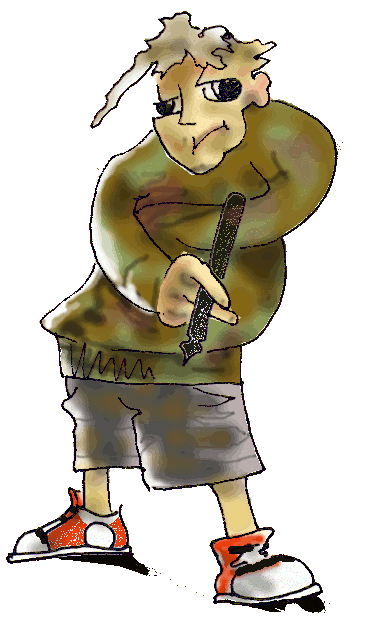Brückentage
War so müde, als ich aus dem Zug stieg, dass ich nicht mehr wußte, wohin ich unterwegs war. Die Türen gingen zu, und ich stand am falschen Bahnhof. Gepäckhalle voller Junkies. Eine Schwangere stalpte barfuß durch die Kälte und schrie andauernd: Ich bin eine Prinzessin. Der heilige Geist stand mit der Spritze im Arm daneben. Junkie wie sie und dem ganzen Wesen nach obendrein ihr Dealer. Tätowierungen überall bis unter die Lippe, rachitischer Nacken, metallene Nasenwurzel. Ein englisches Tattoo wies ihn als heilig aus, der Geist kam aus der Flasche. Und weckte Assoziationen ans Boot. Er schien die werdende Mutter und ihr Kind als Eigentum zu betrachten, kam auf mich zu und zog einen Schlagring aus der Tasche: Glotzn so?
Hatte gleich drei seiner Kumpels am Hals. Alle stoned. Sie prügelten sich vom Fleck weg um meine Tasche. War sowieso nichts wertvolles drin. Trotzdem peinlich, beunruhigend und schlechte Visitenkarte für die ganze Stadt. Die Polizei sah dabei tatenlos zu. Zwei Kietzbullen mit multikulturellem Hintergrund. Am Ende landeten ein paar Scheine in ihren Taschen und die Prinzessin kam mit ner Verwarnung davon, sich nicht so gehen zu lassen. Mich ließen sie laufen, weil gegenüber in einer Synagoge gleichzeitig Bombendrohung war. Klopperei auf der Straße.
Ich ging aus dem Bahnhof mangels Alternativen direkt rein in den Tumult. Wortfetzen ließen sich aus der Luft schnappen von Zukunftschancen für unsere Kinder. Dazu rohe Gewalt in gasförmigem Aggregatzustand. Testosteron, Angst und Gegröle. Mußte an den Heiland vom Bahnhofsklo denken beim Stichwort Chancen und den Stammhalter des heiligen Geistes von der Nadel. Just im Moment ging vor der Synagoge eine Nebelgranate hoch. Ein jämmerliches Ding. Klang und sah aus, als wäre eine Coladose auf den Asphalt geknallt und dabei undicht geworden. Augen zu und durch.
Hörte blind einen Lautsprecher quäken. Jemand mit öliger Stimme sprach von der Notwendigkeit, einen Konsens zu finden. Im Dilemma um die Überfremdung unserer Gesellschaft. Nach der Auseinandersetzung um meine Reisetasche hatte ich auch Konsens. Ich schob mich mit der Stirn voran durch eine Glastür in eine Apotheke hinein, die von innen zugehalten wurde. Bemerkte ich zu spät. Ich fragte nach einer Kopfschmerztablette. Der Zuhalter verwies mich auf die Heilig Geist Apotheke, wahrscheinlich den Arzneischrank des Dealers im Bahnhof. Der Laden hatte wegen besonderer Umstände geschlossen. Kann ich verstehen.
Das Angebot, mir den Weg zurück zu erklären, lehnte ich dankend ab. So läuft das hier, sagte der Apotheker, wir sind eben Provinz, das ist nicht New York oder Mailand. Er sagte wirklich Mailand, als wäre dort das Paradies. Ich war mal in Mailand. Das Paradies war es nicht. Dann also wieder auf die Straße raus. Sternförmig gingen die Gassen vom Bahnhof weg, alle nicht sehr vielversprechend. Ich mußte mich entscheiden. Zeit zu überlegen, gleich Null. Geradeaus ging die Schulstraße weg, kilometerlang erst flach, dann steil den Berg hinauf. Ich nahm mir vor, die Abfahrt des nächsten Zuges nicht aus den Augen zu verlieren. Sonniger Tag, auf der Anhöhe ein Schloss. Ich dachte an Entspannung und eine heiße Tasse Kaffee.
Der Regen überraschte mich auf halber Strecke. Ein widerlicher Regen, nichts halbes, nichts ganzes. SMS in der Tasche. Freunde, die eine Party feierten und sich wunderten, wo ich blieb. Suchte einen ruhigen Platz, um zurück zu smsen. Bei Regen gar nicht leicht. Mittlerweile doch eher übellaunig, entdeckte ich, dass das ferne Schloss von näherem aus gesehen eine Industrieruine war und der Hügel, auf dem es stand, eine Art Müllhalde. Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen, den Tag mit Gewissheiten zu verderben, hielt mich also querab des Hügels zum Fluß hin links.
Flüsse sind eigentlich immer gut, und der hier hatte eine ansehnliche Breite. Es gab eine Bank mit Blick auf das Gewässer. Wenn das mal nicht, dachte ich, Mailand ist. Ruhe, Regen und Enten. Sowas um die sieben Minuten himmlischer Frieden, dann kam ein Kegelclub vorüber. Der Platz neben mir blieb auch nicht lange frei. Ein Kerl, anfangs freundlich, setzte sich, rückte näher, schob mich quasi mit Freundlichkeit von der Bank und wies dabei permanent auf andere Sitzgelegenheiten hin, die alle noch frei und mindestens genauso schön seien. Und besser zu mir passten.
Konkurrenz unter Gleichgesinnten nimmt selbst einer sonnigen Uferbank den Reiz. Erst recht bei schlechtem Wetter. Eine weitere SMS informierte mich, was jetzt gerade im Leben der Partygesellschaft abging. Wer mit wem und überhaupt. Alles gute Laune. Ich nicht. Man will kein Spielverderber sein. Ich verkniff mir die Antwort und dachte darüber nach, wie ich meinen Aufenthalt möglichst schnell beenden konnte. War nicht schmeichelhaft für einen Ort, der vom Tourismus lebt, aber auch nicht meine Schuld. Trotzdem redeten mir Werbeplakate ein schlechtes Gewissen ein. Man konnte ihnen kaum entgehen. Sie waren mit Info-Tafeln gekoppelt, auf denen die Wege beschrieben sind.
Überall hin, nur nicht weg. Also auch der Weg zum Bahnhof nicht, oder schlecht oder ungenau. Schwer zu sagen, jedenfalls kam man nach der Beschreibung dieser Taugenichtse von Infotafeln nirgendwo an. Man wurde allerdings rundum gut informiert darüber, dass das Nirgendwo, das man gerade betreten hatte, was ganz besonderes war. Historisch und kulturell und so weiter. Erstmalig zweifelte ich an meinem Verstand. Gibt Momente, in denen man sich nicht mehr sicher ist. Womöglich im Zug eingepennt und alles nur geträumt? Vielleicht wache ich gleich – in Mailand? – auf und werde nach meinem Fahrschein gefragt.
Ich stand tatsächlich minutenlang vor einer Schaufensterscheibe und wartete darauf, dass mich ein Kontrolleur weckt. Dann irgendwann sah ich durch die Scheibe durch Brautmoden und Familienfotos. Frische Ehepaare, die eher ernsthaft als fröhlich wirkten. Dressierte Kinder und der provinzielle Portraitcharme starker Frauen. Irgendwie fühlte ich eine Ohnmacht kommen. Freute mich aber darauf, weil so die Chance wuchs, in diesem Zug nach irgendwohin neben dem Schaffner aufzuwachen.
Allmählich steigerte sich die Angst. Mein Reiseziel fiel mir partout nicht mehr ein, und die Möglichkeit wuchs, dass ich gar keins hatte. Allenfalls hätte im Sinne Der Weg ist das Ziel ... der Ort, an dem ich stand, auch der Ort gewesen sein können, an den ich hin gehörte. Nicht tot überm Zaun, dachte ich. Nicht hier. Naja, und schon stand ich wie bestellt gedankenverloren an der Friedhofsmauer. Und ging die Grabsteine durch. Vielleicht findet man ja irgendwo seinen eigenen Namen. Gruselig. Die Idee zu einer Geschichte, in der jemand solches erlebt und am Ende begreift, dass er einem Zugunglück zum Opfer fiel und daher nun tot in fremden Örtern wandelt.
Immer einen Schritt vor den anderen und geradeaus, bis Gleise in Sicht kommen, dann nichts wie am Heiligen Geist vorbei gemogelt in den Bahnhof rein, den nächsten Zug genommen, irgendwohin, nur weg. Soweit der Plan. Alternativ wäre die letzte Lösung, in den Fluß zu springen und zu warten, bis man von selbst das Meer erreicht. Oder die Müllabscheideanlage der nächsten Staustufe, wenn es schlecht läuft. Das Leben ist ein einziger fauler Kompromiss zu Ungunsten der eigenen Wünsche. Orte wie dieser lehren einen, diese eiserne Regel zu brechen. Kompromisse beginnen mit Trägheit. Trägheit ist eine Todsünde. Mittlerweile wußte ich, warum.
Man muss in Bewegung bleiben. Ich ging am Flussufer entlang stromab in der Hoffnung, dort auf eine Eisenbahnbrücke zu treffen. Entweder laufen Gleise an Flüssen entlang, oder sie queren sie. In irgendeiner Form musste sich mein Problem mit dieser Erkenntnis lösen lassen. Mein Weg war untrennbar mit dem des Wassers verbunden. Axiome, die Hoffnung spenden. Es traf die dritte SMS-Welle ein. Die ferne Party war schon ohne mich über ihren Zenit. Man fragte sich nicht mehr, wo ich bliebe, spendete allerdings ausgiebig Mitgefühl für den, der das Beste verpasst hat. Ich dachte einen Moment darüber nach, mein Handy statt meiner den Fluten zu übergeben. Das eigene Leid erträgt sich leichter, wenn man nicht ständig mit der guten Laune der Umwelt bombardiert wird.
Es wurde allmählich dunkel um mich her. Ich hielt es erst für jahreszeitlich bedingt, dann schrieb ich es dem Hunger zu, psychosomatischen Ursachen und schließlich blickte ich auf die Uhr. Tatsächlich war rein rechnerisch gesehen, der halbe Tag bereits vergangen. Und rein meteorologisch gesehen, ist die dunklere Hälfte des Tages nunmal Nacht. Die kam. Und legte ihre kalten Finger in meinen Nacken. Ein Moment, in dem selbst flüchtige Touristen überall nur nicht weg auf Parkbänken, in Nieschen und Arkaden Bewohner entdecken, seien es welche aus dem Tierreich oder Obdachlose. Jeder Winkel ist besetzt. Man möchte nicht glauben, wie gut die Vorsorge funktioniert, wenn man sie rechtzeitig und mit Nachdruck betreibt, und wie schlecht, wenn man sie beizeiten vermasselt.
In der Hoffnung vielleicht, dass sich die Dinge noch vor dem Abend zum Guten wenden. Das tun sie nie. Die Stunden schienen wie Blätter auf einem Daumenkino heruntergespult worden zu sein. Ich versuchte, mich zu erinnern, was ich den Nachmittag über getan hatte. Es fiel mir nichts ein, wofür es sich lohnte, morgens aufzustehen. Man musste sich belohnen. Irgendwie. Und dann sah ich, wie sich die Penner auf den Parkbänken belohnen. 1,99 der Liter. Ist wirklich schwer, sich einzugestehen, wie knapp die Linie zwischen Aufstieg und Absturz ist. Zwischen hier und da. Und wie schwer zu entscheiden, ob man hier oder schon da oder da schon immer war. Und die Sache mit dem fehlenden Ziel kam mir wieder in den Sinn.
Ich war wie belämmert, als ich in den letzten Zug einstieg. Konnte mich an absolut nichts mehr erinnern als daran, mich selbst zu hassen. Für den Ausstieg, für mein fehlendes Ziel, für das fehlende Gespür von Zeit, für die hilflosen Strategien, dem allen zu entkommen. Kaum saß ich in dem Zug, kam der Schaffner und fragte mich nach dem Fahrschein, den ich nicht hatte. Die Geschichte, die ich ihm vom Heiligen Geist und seinen Taschenräubern erzählen konnte, interessierte ihn wenig. Er baute sich vor mir auf wie ein Denkmal und ließ mich wissen, dass am nächsten Bahnhof Endstation wäre.
Einen Moment dachte ich darüber nach, wie schön es in dieser Stadt am Fluß gewesen war mit seinem Schloss am Berg und dem Fluß im Tal und wie undankbar jeder, der das alles nicht genießen konnte. Aber immerhin bestand ja noch Hoffnung, dass die nächste Stadt besser, glücklicher, friedlicher wäre als die letzte. Und plötzlich fiel mir wieder ein, was ich gehofft hatte, als ich vor dem letzten Bahnhof erwacht war.
Dasselbe
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer