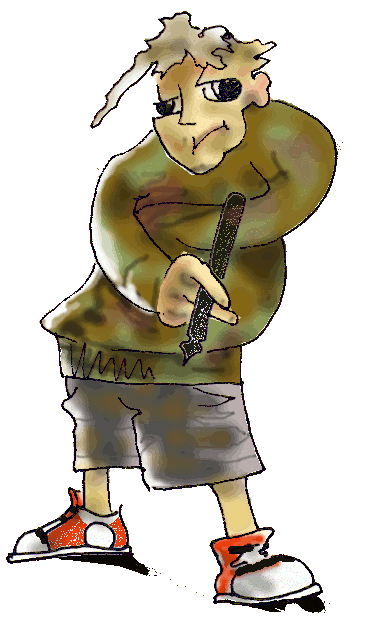El Camino
Seit drei Monaten bin ich nun in Spanien, einen davon habe ich in Ayamonte verbracht. Dieser Ort ist an der Küste gelegen, direkt an der Grenze zu Portugal. Zwischen beiden Ländern fließt ein breiter Fluss, der Guadiana. Es heißt, von hier aufwärts bis Badajoz verlaufe eine der ältesten Grenzen Europas, seit dem 13ten Jahrhundert bestehe sie in dieser Form. Auch ich fühle mich, als sei ich an einer Grenze angekommen. Wir haben diese Reiseleitungen gemacht, in Bussen Urlauber durch Andalusien und die Algarve begleitet, und jetzt fällt ein innerer Vorhang und die Schausteller dieser Reise sinken zwischen ihren Requisiten in einen tiefen Erholungsschlaf. Seit einem Monat geht das so. Was noch an Personal in der Gegend ist, schleppt sich erschöpft durch die mörderische Hitzewelle des Juni. Die eine oder andere Romería, Wallfahrt zu Pferde, ein Picknick am Strand, Barbeque mit Wein und gegrilltem Fisch. Die Uhren gehen mal vorwärts, mal zurück, wie es ihnen gerade passt. Und mir kommt es allmählich vor, als hätte eine höhere Macht mich nach unserer Reise unversehens in einer Schublade verstaut. Ich hatte versucht, zu schreiben, doch scheiterten alle Ansätze an den einfachen Dingen, die man einfach so nennt, weil man für sie keinen passenden Namen findet. Fehlende Arbeitsumgebung, Tastaturen mit seltsamen Inkompatibilitäten, versteckten Lesebrillen, immer wieder falsche Uhrzeiten und nicht aufgeladene Batterien, von was auch immer. Seit einigen Tagen nun höre ich diese Stimme, die mich auffordert zu gehen. Ich müsse weg, doch beim ernstesten Nachdenken tut sich kein Ziel auf: wohin?
Es ist nämlich kein weg zu erkennen im Sinne einer Flucht, sondern ein Weg im Sinne eines auf mich wartenden Erlebens. Zu Fuß am besten. Mein Auto ist müde. Und gleich muss ich mich selber bremsen; der Weg nämlich, den ich ausersehen habe, mich zu neuen Erfahrungen zu tragen, ist ein staubiger Camino de los Rancheros, auf den sich möglicherweise alle paar Wochen mal ein Geländewagen verirrt, um den Eseln und Maultieren, die auf ihren Weiden trocknen, Wasser und Aufsicht zu spenden; danach gehört er wieder den Zirpen, Grillen und Disteln. Was mich daran reizt, dessen Schotter unter meinen Sohlen knirschen zu hören, wenn die Sonne von oben herab unerbittlich brennt, und ein Rucksack drückt, ist mir selbst ein Rätsel. Es muss etwas geben, was jenseits der Einöde auf Entdeckung wartet. Etwas wundervolles, etwas magisches. Es muss etwas geben, von dem ich möglicherweise geträumt habe in den Nächten, als die Temperatur nicht unter die 30° sinken wollte, eine Art Fiebertraum einer bevorstehenden Expedition. Nennen wir es ruhig einen Sonnenstich! Dort, wo es mich hinzieht, jedenfalls, zieht es auch die Wolken hin, wenn mal welche am Horizont erscheinen. Vielleicht bin ich krank. Wenn nicht ganz gewiss, krank von einer Zivilisation, die mit Megaherzen getaktet ist. Mensch, wie fröhlich steht mein Auto am Straßenrand, wenn es dort vor sich hin dösen kann und mit einem kurzen Blick zwischen den halboffenen Lidern zu verstehen gibt: Lass mich mal einfach für ein paar Wochen hier stehen!
So in etwa ist meine Stimmung an diesem Mittwoch am Monatsende des Juni, als ich zum dritten Mal den kleinen Rucksack gepackt und wieder ausgepackt habe …
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer